blog
Lipödem Behandlung
Lipödem Düsseldorf: Beine, Arme, Bauch & mehr - Jetzt mehr zur Lipödem-Behandlung erfahren
Lipödem gilt ohne Behandlung als unheilbar und nahezu jede 10. Frau leidet unter schmerzhaften, unverhältnismäßig dicken / fettreichen Körperstellen. Dies betrifft v.a. Beine oder Arme– ohne zu wissen, dass ein Lipödem dahintersteckt. Klassische Diäten oder Sport helfen hier meist nicht, da es sich um eine krankhafte Fettverteilungsstörung handelt. In Düsseldorf unterstützt Taina Thoma betroffene Patientinnen als Lipödem-Spezialistin mit modernen, schonenden Verfahren wie der WAL Fettabsaugung (Water-Assisted Liposuction). Ergänzend kommen innovative Kombinationsbehandlungen wie Inmode Ignite, Morpheus8, Sculptra oder Lipsona zum Einsatz, um ein harmonisches und langanhaltendes Ergebnis erzielen zu können. So können Betroffene nicht nur optische Verbesserungen, sondern vor allem mehr Lebensqualität und Wohlbefinden im Alltag erhalten. Suchen Sie noch einen Lipödem Arzt? Taina Thoma steht Ihnen jederzeit persönlich zur Seite – individuell auf Ihr Lipödem-Stadium angepasst.
Doc. Taina Thoma (Spezialisierte Ärztin in Düsseldorf)

Häufige Suchen für Lipödem Anzeichen
- Nach Körperform / Aussehen
- „dicke Beine trotz Sport“
- „Oberschenkel werden nicht dünner“
- „warum sind meine Beine viel dicker als der Rest vom Körper“
- „unproportional dicke Beine“
- „dicke Arme und Beine, Bauch normal“
- Nach Schmerzen / Beschwerden
- „Beine tun weh bei Berührung“
- „blaue Flecken ohne Grund“
- „schwere Beine abends“
- „Druckschmerzen in den Beinen“
- „Beine fühlen sich gespannt an“
- Nach Diät / Abnehmen
- „trotz Diät keine dünneren Beine“
- „warum nehme ich nur am Bauch ab, nicht an den Beinen“
- „Sport hilft nicht gegen dicke Oberschenkel“
- „Abnehmen Beine klappt nicht“
- Nach Gefühlen / Alltag
- „Beine immer geschwollen“
- „Hosen passen nicht trotz normalem Gewicht“
- „warum bekomme ich so schnell schwere Beine“
- „Cellulite extrem schlimm“
- Nach möglichen Fehldiagnosen
- „Lymphödem Symptome“
- „Wasser in den Beinen“
- „Venenschwäche“
- „dicke Beine durch Hormone“
Ablauf einer Lipödem-OP mit WAL
Die WAL-Methode (Water-Assisted Liposuction) gilt heute als besonders schonende und effektive Technik zur Behandlung des Lipödems. Der Eingriff erfolgt in mehreren Schritten:
- Beratung & Planung
Vor der Lipödem-OP erfolgt eine ausführliche Untersuchung durch Taina Thoma. Dabei werden Ausprägung und betroffene Körperareale analysiert und ein individueller Behandlungsplan erstellt.
- Lokale Betäubung
Die Lipödem-OP erfolgt in Lokalanästhesie in Düsseldorf (Meerbusch)
- Gewebeschonende Fettabsaugung
Mithilfe eines feinen Wasserstrahls wird das krankhafte Fettgewebe sanft aus dem Bindegewebe gelöst und abgesaugt. Diese Technik reduziert Belastungen für Lymphbahnen, Gefäße und Haut.
- Konturierung & Symmetrie
Während der OP achtet Frau Thoma als Lipödem-Expertin darauf, harmonische Körperkonturen zu schaffen und die natürliche Silhouette zu bewahren
- Nachsorge & Heilung
Direkt nach dem Eingriff erhalten Patientinnen spezielle Kompressionskleidung. Schonendes Verhalten, ggf. Lymphdrainage und regelmäßige Kontrollen unterstützen den Heilungsprozess sowie weitere Behandlungsmaßnahmen
Der große Vorteil der WAL-Methode als Lipödem-Fettabsaugung: Weniger Schwellungen und Blutergüsse, eine kürzere Erholungszeit und nachhaltige Ergebnisse für Betroffene.
Internationale Erfahrung – Ihr Vorteil
„Seit vielen Jahren bin ich als Referentin international tätig und schule Ärztinnen und Ärzte weltweit in modernen Behandlungsmethoden. Dieses Wissen und die Erfahrungen aus dem globalen Austausch fließen direkt in meine Arbeit ein – und bereichern die Konzepte, die ich meinen Patientinnen und Patienten anbiete.“ – Doc. Taina Thoma in Düsseldorf


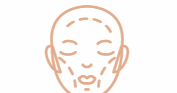
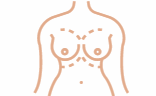
Lipödem Stadien im Überblick
Das Lipödem entwickelt sich schleichend und zeigt sich in drei unterschiedlichen Stadien. Je früher eine Diagnose gestellt wird, desto gezielter kann die Lipödem-Behandlung erfolgen.
Lipödem Stadium 1 – Weiches Fettgewebe und glatte Hautoberfläche
Im ersten Stadium wirkt die Haut noch relativ glatt, jedoch zeigen sich bereits eine symmetrische Vermehrung des Fettgewebes an Beinen und/oder Armen. Betroffene bemerken oft eine Neigung zu Blutergüssen, Druckschmerzen oder ein dauerhaftes Spannungsgefühl. Sport und Diäten führen kaum zu Veränderungen in den betroffenen Arealen.
Lipödem Stadium 2 – Knotenbildung und unebene Haut an Beinen, Bauch & Co.
In diesem Stadium wird das Fettgewebe zunehmend unregelmäßig. Unter der Haut entstehen tastbare Knoten und Dellen, die Hautoberfläche wirkt grobkörniger. Schmerzen, Druckempfindlichkeit und Schwellungen nehmen zu. Das Ungleichgewicht zwischen schlankem Oberkörper und voluminösen Extremitäten wird deutlicher sichtbar.
Lipödem Stadium 3 – Deutliche Gewebeveränderungen und Fehlstellungen
Das Fettgewebe ist stark verhärtet, großknotig und führt zu massiven Umfangsvermehrungen der Beine oder Arme. Es kann zu Hautlappenbildungen und Einschränkungen der Beweglichkeit kommen. In manchen Fällen entwickeln sich Fehlstellungen der Gelenke oder zusätzliche Beschwerden wie Arthrose. Alltag und Lebensqualität sind nun stark beeinträchtigt.
Betroffene Körperzonen beim Lipödem
Ein Lipödem entwickelt sich schrittweise und betrifft bestimmte Körperregionen, die sich meist symmetrischverändern. Die typischen Zonen zeigen charakteristische Merkmale und Beschwerden, die für Patientinnen im Alltag sehr belastend sein können.
Lipödem Beine, Oberschenkel und Hüfte
Die Beine und v.a. Oberschenkel gehören zu den am häufigsten betroffenen Körperbereichen beim Lipödem. Schon im frühen Stadium kommt es hier zu einer deutlich sichtbaren Fettvermehrung, die nicht auf Diäten oder Sport anspricht. Viele Patientinnen berichten von dicken Reiterhosen, die optisch unharmonisch wirken und bei Bewegungen aneinander reiben. Typisch ist auch das Spannungsgefühl in den Beinen, das besonders nach längerem Sitzen oder Stehen zunimmt. An den Hüften zeigt sich die Erkrankung durch eine verbreiterte Silhouette, sodass der Unterkörper insgesamt breiter wirkt als der Oberkörper. Trotz normalem Gewicht oder schlankem Bauch wirken die Oberschenkel und Hüften unverhältnismäßig stark ausgeprägt.
Lipödem am Unterschenkel und Waden
Im Verlauf des Lipödems können auch die Waden und Unterschenkel betroffen sein. Viele Frauen klagen über schwere, gespannte Beine, die sich besonders abends dick und müde anfühlen. Anders als beim Lymphödem sind die Füße in der Regel nicht betroffen, wodurch ein typischer Übergang am Knöchel sichtbar bleibt. Die Unterschenkel wirken dadurch auffallend rund und voluminös, was oft zu Problemen bei der Kleider- oder Schuhwahl führt. Hinzu kommt eine starke Druckempfindlichkeit: Schon leichtes Anstoßen oder Berühren kann Schmerzen auslösen. Nicht selten entstehen an den Waden auch blaue Flecken ohne ersichtlichen Grund, da die Gefäße im betroffenen Gewebe empfindlicher reagieren.
Lipödem Arme & Oberarme
Auch die Arme sind eine typische Lipödem-Zone. Besonders die Oberarme nehmen symmetrisch an Umfang zu, während Unterarme und Hände schlank bleiben. Viele Patientinnen berichten, dass T-Shirts oder Blusen im Schulter- und Armbereich spannen, obwohl der Rest der Kleidung problemlos sitzt. Durch die zunehmende Fettansammlung wirken die Arme schwer und unbeweglich, was nicht nur optisch stört, sondern auch den Alltag einschränken kann. Viele Betroffene empfinden die Lipödem-Arme als besonders belastend, da sie die Krankheit für andere sichtbar machen und die Körperproportionen deutlich verändern. Auch hier sind Schmerzen, Druckempfindlichkeit und Neigung zu Hämatomen typische Begleiter.
Po- und Lipödem Knie
Das Lipödem kann sich ebenfalls im Bereich des Gesäßes und der Knie zeigen. Am Po entstehen vergrößerte Fettpolster, die nicht durch Sport oder Ernährungsumstellungen reduziert werden können. Besonders an den Knieinnenseiten bilden sich auffällige Fettansammlungen, die das Laufen erschweren und zu einem Reibungsgefühl führen. Viele Patientinnen berichten, dass die Knie dicker wirken, was zu Bewegungseinschränkungen oder Fehlbelastungen der Gelenke führen kann. Hinzu kommt die psychische Belastung: Durch die unproportionale Verteilung von Po und Beinen fühlen sich Betroffene oft missverstanden und unwohl in ihrer Haut.
Lipödem und Lymphödem – Unterschiede, Gemeinsamkeiten und medizinische Hintergründe
Das Lipödem und das Lymphödem sind zwei völlig unterschiedliche Krankheitsbilder, die jedoch häufig miteinander verwechselt werden. Beide gehen mit einer sichtbaren Volumenzunahme der Extremitäten einher, haben aber unterschiedliche Ursachen, Verläufe und Behandlungsmöglichkeiten. Für eine erfolgreiche Therapie ist es entscheidend, die Erkrankungen klar voneinander abzugrenzen.
Lipödem – eine Fettverteilungsstörung
Das Lipödem ist eine chronische, fortschreitende Erkrankung des Fettgewebes, die fast ausschließlich Frauen betrifft. Charakteristisch ist eine symmetrische Vermehrung des Unterhautfettgewebes an Beinen, Hüften, Gesäß und oft auch an den Armen, während Füße und Hände ausgespart bleiben. Typische Symptome sind:
- Druckschmerzen und Spannungsgefühl in den betroffenen Arealen
- schnelle Bildung von Hämatomen (blaue Flecken) ohne ersichtlichen Grund
- Gefühl schwerer, müder Beine, besonders am Abend
- ausbleibender Behandlungserfolg trotz Diät oder Sport
Das Lipödem wird in drei Stadien eingeteilt, die von weichem Fettgewebe mit glatter Hautoberfläche bis hin zu grobknotigen Strukturen und massiven Gewebeveränderungen reichen. Neben den körperlichen Beschwerden leiden viele Patientinnen auch psychisch unter den sichtbaren Veränderungen. Die Ursache ist bis heute nicht vollständig geklärt, genetische Faktoren und hormonelle Umstellungen (Pubertät, Schwangerschaft, Wechseljahre) scheinen jedoch eine entscheidende Rolle zu spielen.
Lymphödem – eine Abflussstörung der Lymphflüssigkeit
Im Gegensatz dazu ist das Lymphödem eine Erkrankung des Lymphsystems. Es entsteht, wenn der Abfluss von Lymphflüssigkeit gestört ist, sodass sich Eiweiße und Flüssigkeit im Gewebe stauen. Dies führt zu einer sichtbaren Schwellung, die meist einseitig beginnt und im Verlauf auch andere Regionen betreffen kann. Typische Merkmale sind:
- deutliche Schwellung mit Eindrückbarkeit (Stemmer-Zeichen positiv)
- Hautverdickungen und Veränderungen im fortgeschrittenen Stadium
- Schweregefühl, aber meist weniger Druckschmerzen als beim Lipödem
- Füße oder Hände sind in der Regel mitbetroffen
Ein Lymphödem kann primär auftreten (angeborene Fehlanlage der Lymphbahnen) oder sekundär entstehen, beispielsweise nach Operationen, Verletzungen, Infektionen oder Tumorerkrankungen, die das Lymphsystem schädigen.
Abgrenzung zwischen Lipödem und Lymphödem
Die Unterscheidung ist für die Therapie entscheidend. Während beim Lipödem vor allem das Fettgewebe krankhaft vermehrt ist, handelt es sich beim Lymphödem um ein Abflussproblem der Lymphflüssigkeit. Ein weiterer wichtiger Unterschied: Beim Lipödem bleiben Füße und Hände fast immer schlank, beim Lymphödem sind sie häufig mitbetroffen. Zudem ist das Lipödem meist symmetrisch ausgeprägt, das Lymphödem dagegen eher einseitig.
Behandlung Lipödem und Lymphödem
Die Behandlung unterscheidet sich grundlegend:
- Beim Lipödem ist die einzige dauerhafte Lösung die operative Entfernung des krankhaften Fettgewebes, z. B. durch die WAL-Methode (Water-Assisted Liposuction). Ergänzend können moderne Verfahren wie Morpheus8, Ignite, Sculptra oder Lipsona eingesetzt werden, um Haut und Gewebe zu straffen.
- Beim Lymphödem steht die konservative Therapie im Vordergrund, insbesondere die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (KPE) mit manueller Lymphdrainage, Kompression, Bewegungstherapie und Hautpflege.
Obwohl Lipödem und Lymphödem ähnliche Symptome verursachen können, handelt es sich um zwei unterschiedliche Erkrankungen. Eine präzise Diagnose durch eine erfahrene Ärztin wie Taina Thoma in Düsseldorf ist entscheidend, um die richtige Behandlung einzuleiten. Nur so lassen sich Beschwerden langfristig lindern und die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig verbessern.
Lipödem Alter – Ab wann fängt es an?
Das Lipödem ist eine chronische Fettverteilungsstörung, die fast ausschließlich Frauen betrifft. Typischerweise macht sich die Erkrankung in Phasen hormoneller Veränderungen erstmals bemerkbar. Häufige Zeitpunkte für den Beginn sind die Pubertät (ca. 85%), die Schwangerschaft oder die Wechseljahre. In diesen Lebensabschnitten kommt es zu einem veränderten Hormonhaushalt, der das Wachstum des krankhaften Fettgewebes begünstigen kann.
Besonders auffällig: Schon junge Mädchen können erste Symptome entwickeln, oft in Form von plötzlich dicker werdenden Beinen, die sich nicht durch Ernährung oder Sport beeinflussen lassen. Viele Betroffene berichten, dass sie ab der Pubertät „einfach nicht mehr in Proportion waren“ – während Oberkörper und Taille schlank blieben, nahmen Oberschenkel, Hüften oder Arme sichtbar an Umfang zu.
Das Lipödem kann sich über Jahre langsam entwickeln und wird nicht selten erst spät diagnostiziert. Manche Frauen bemerken es erst in den 30ern oder 40ern, wenn die Schmerzen, Schwellungen oder Blutergüssestärker werden. Je früher die Erkrankung erkannt wird, desto besser lassen sich Folgeschäden wie Fehlbelastungen der Gelenke oder psychische Belastungen verhindern. Deshalb ist es wichtig, bereits bei ersten Anzeichen – wie symmetrischen Fettpolstern an Beinen oder Armen – ärztlichen Rat einzuholen.
Lipödem Schmerzen – was tun?
Ein zentrales Symptom des Lipödems sind die typischen Schmerzen in den betroffenen Körperregionen. Sie entstehen durch den Druck des krankhaft vermehrten Fettgewebes auf umliegende Strukturen wie Nerven, Blut- und Lymphgefäße. Viele Patientinnen beschreiben ein Spannungsgefühl, Druckschmerzen oder schwere Beine, die sich im Laufe des Tages verstärken. Schon leichte Berührungen oder kleine Stöße können zu starken Schmerzen oder Blutergüssen führen.
Um die Schmerzen zu lindern, gibt es verschiedene Maßnahmen:
- Kompressionskleidung: Spezielle Strümpfe oder Hosen verbessern die Mikrozirkulation, entlasten das Gewebe und reduzieren das Spannungsgefühl.
- Lymphdrainage & Bewegung: Manuelle Lymphdrainagen und gelenkschonender Sport wie Schwimmen, Radfahren oder Aquafitness können Schwellungen und Schmerzen verringern.
- Ernährung & Lebensstil: Auch wenn Diäten das Lipödem nicht heilen, hilft eine gesunde, entzündungsarme Ernährung, die Beschwerden abzumildern.
- Operative Behandlung: Die wirksamste Lösung, um die Schmerzen langfristig zu reduzieren, ist die Fettabsaugung mittels WAL-Methode. Durch die Entfernung des krankhaften Fettgewebes sinkt der Druck im Gewebe, was nachweislich zu einer deutlichen Schmerzreduktion und mehr Beweglichkeit führt.
Verbindung Lipödem & Hashimoto
Die Assoziation zwischen Lipödem und Hashimoto-Thyreoiditis rückt zunehmend in den Fokus klinischer Forschung, da beide Krankheitsbilder vorwiegend Frauen betreffen und immunologische wie hormonelle Faktoren involviert sind. Lipödem stellt wie bereits mehrfach aufgeführt eine chronisch-progrediente Fettverteilungsstörung dar, während Hashimoto-Thyreoiditis die häufigste Form der autoimmunen Hypothyreose darstellt. Epidemiologische Beobachtungen zeigen, dass ein signifikanter Anteil der Patientinnen mit Lipödem auch eine Schilddrüsenfunktionsstörung, insbesondere Hashimoto, aufweist.
Pathophysiologisch lässt sich eine mögliche Schnittstelle in der Dysregulation des Immunsystems vermuten. Hashimoto ist durch eine lymphozytäre Infiltration der Schilddrüse mit Bildung von Autoantikörpern (anti-TPO, anti-Tg) gekennzeichnet, was zu einer verminderten Schilddrüsenhormonproduktion führt. Schilddrüsenhormone wiederum haben einen direkten Einfluss auf Lipidstoffwechsel, Gewebsperfusion und Kapillardurchlässigkeit. Hypothyreote Zustände begünstigen interstitielle Flüssigkeitsansammlungen und können somit das Ödemgefühl bei Lipödem-Patientinnen verstärken.
Zudem wird diskutiert, dass eine hormonelle Dysbalance im Zusammenhang mit Östrogen- und Schilddrüsenhormonrezeptoren die Proliferation und Differenzierung von Adipozyten im lipödemtypischen Muster beeinflusst. Weiterhin spielt eine chronische, niedriggradige Entzündung („low grade inflammation“) bei beiden Erkrankungen eine zentrale Rolle. Proinflammatorische Zytokine, die bei Hashimoto erhöht sind, könnten auch die pathologische Fettgewebsvermehrung und Schmerzempfindlichkeit beim Lipödem modulieren.
Klinisch relevant ist, dass Patientinnen mit kombinierter Diagnose häufig über ausgeprägtere Fatigue, Kälteintoleranz und verstärkte Gewichtsdysregulation klagen. Diagnostisch sollte daher bei Lipödem-Patientinnen routinemäßig eine Schilddrüsendiagnostik mit TSH, fT3, fT4 und Antikörperbestimmung erfolgen. Therapeutisch ist eine adäquate Schilddrüsensubstitution essenziell, um die Symptomlast zu reduzieren und konservative Maßnahmen des Lipödems zu optimieren.
Insgesamt deutet die Datenlage darauf hin, dass Lipödem und Hashimoto-Thyreoiditis nicht nur zufällig koexistieren, sondern über immunoendokrine Mechanismen pathophysiologisch verknüpft sind. Zukünftige Studien sind erforderlich, um kausale Zusammenhänge zu bestätigen und integrative Therapiekonzepte zu entwickeln.
Lipödem vs. Adipositas
Ätiologie & Pathogenese
- Lipödem:
- Chronische, vermutlich hormonell und genetisch bedingte Fettverteilungsstörung.
- Gekennzeichnet durch Dysfunktion der Mikrozirkulation, erhöhte Kapillarpermeabilität und Schmerzhaftigkeit.
- Hauptsächlich Frauen, oft mit Beginn in hormonellen Umbruchphasen (Pubertät, Schwangerschaft, Menopause).
- Adipositas:
- Multikausale Erkrankung infolge chronischer Energiezufuhr > Energieverbrauch.
- Verstärkt durch genetische Faktoren, Bewegungsmangel, Ernährung, endokrine Störungen.
- Führt zu generalisierter Zunahme von Fettmasse, insbesondere viszeral.
Verteilungsmuster
- Lipödem:
- Symmetrische Fettvermehrung an Beinen, Hüften, Gesäß und teils Armen.
- Hände und Füße ausgespart → „Stiefel- oder Reithosenphänomen“.
- Adipositas:
- Generalisierte Fettansammlung, häufig Betonung im Abdomen (viszerale Adipositas).
- Extremitäten proportional betroffen.
Klinik
- Lipödem:
- Druckschmerz, Berührungsempfindlichkeit, Neigung zu Hämatomen.
- Schwere- und Spannungsgefühl, Ödemneigung, trotz normalem BMI möglich.
- Psychische Belastung durch Disproportion.
- Adipositas:
- Typisch: Dyspnoe, Gelenkbelastung, metabolische Folgen (Diabetes Typ 2, Hypertonie, Dyslipidämie).
- Kein disproportionales Schmerzsyndrom.
- Kein typischer Hämatom-Befund.
Diagnostik
- Lipödem:
- Klinische Diagnose (Inspektion, Palpation, Anamnese).
- BMI oft nicht aussagekräftig.
- Bildgebung (Sonografie, MRT) zur Differenzierung möglich.
- Adipositas:
- Diagnose über BMI ≥ 30 kg/m² und zusätzliche Parameter (Taillenumfang, Fettverteilung).
- Labor: Stoffwechselparameter, Endokrinstatus.
Therapie
- Lipödem:
- Konservativ: Kompression, Lymphdrainage, Bewegung, Hautpflege.
- Operativ: Liposuktion.
- Diät und Sport verbessern Begleiterkrankungen, reduzieren aber das lipödemspezifische Fett nicht.
- Adipositas:
- Basis: Ernährungs- und Bewegungstherapie, Verhaltenstherapie.
- Medikamentöse Ansätze (z. B. GLP-1-Agonisten).
- Bariatrische Chirurgie bei schwerer Adipositas.
Kurz: Adipositas = generalisierte Fettansammlung, metabolisch relevant. Lipödem = disproportionale Fettverteilungsstörung, schmerzhaft, therapieresistent gegen Diät.
Häufige Fragen (FAQ) zur Lipödem Behandlung & Allgemein
Das Lipödem weist eine deutliche genetische Komponente auf. Viele Patientinnen berichten über eine familiäre Häufung, häufig bei Mutter oder Schwestern. Studien legen nahe, dass ein autosomal-dominanter Erbgang mit unvollständiger Penetranz vorliegt, was bedeutet, dass nicht jede Trägerin der genetischen Veranlagung erkrankt. Hormonelle Umbruchphasen wie Pubertät, Schwangerschaft oder Menopause wirken dabei oft als Auslöser. Zudem wird eine Beteiligung von Genen des Fettstoffwechsels und der Östrogenregulation diskutiert, auch wenn die genauen molekularen Mechanismen bisher nicht abschließend geklärt sind.
Lipödem tritt fast ausschließlich bei Frauen auf, die Prävalenz liegt schätzungsweise bei 10–15 % der weiblichen Bevölkerung. Männer sind nur in Einzelfällen betroffen, meist im Zusammenhang mit hormonellen oder genetischen Störungen. Beschrieben wurden Fälle bei Patienten mit Hypogonadismus, Leberzirrhose oder nach Testosteronmangel-Therapie. In größeren Studien liegt der Männeranteil bei unter 1 %. Klinisch zeigt sich das gleiche Muster wie bei Frauen: symmetrische Fettvermehrung an den Extremitäten, Schmerzen und Hämatomneigung. Damit gilt Lipödem bei Männern als seltene, aber klar dokumentierte Erkrankung.
Nach einer Lipödem-Operation berichten Patientinnen typischerweise über moderate, gut kontrollierbare Schmerzen, die sich deutlich von den chronischen Druck- und Spannungsschmerzen des Lipödems unterscheiden.
Direkt postoperativ: Brennen, muskelkaterähnliche Beschwerden und Druckschmerz an den behandelten Arealen.
Intensität: Meist leicht bis mittelstark (VAS 3–5/10), individuell unterschiedlich; selten stärker.
Dauer: Akute Schmerzen halten in der Regel wenige Tage bis etwa 2 Wochen an, mit deutlicher Besserung durch Kompression und Kühlung.
Medikation: Nicht-opioide Analgetika (z. B. Ibuprofen, Paracetamol) reichen fast immer aus.
Besonderheit: Viele Betroffene empfinden die postoperativen Schmerzen als „anders und erträglicher“ im Vergleich zu den typischen Lipödemschmerzen.
Aktuelle Regelung (Stand 2025)
Geltungsbereich: Liposuktion bei Lipödem Stadium III ist befristet bis 31. Dezember 2024 zur Kassenleistung erklärt wordenMediAnwaltssucheS-thetic.
Voraussetzungen für Kostenübernahme:
Gesicherte Diagnose durch Fachärzt*innen (z. B. Angiologie, Phlebologie, Dermatologie, Physikalische & Rehabilitative Medizin)MediStiftung WarentestLipedemPortalWikipedia.
Mindestens 6-monatige konservative Therapie (Kompression, Lymphdrainage, Bewegung) ohne ausreichenden ErfolgMediStiftung WarentestLipedemPortalWikipedia.
BMI ≤ 35 kg/m²; bei BMI > 35 muss zuerst Adipositas behandelt werdenMediStiftung WarentestWikipedia.
Stabile Gewichtsentwicklung in den letzten 6 MonatenStiftung WarentestLipedemPortalWikipedia.
Prüfverfahren: In vielen Fällen erfolgt eine Einzelfallprüfung durch MDK. Es besteht oft hoher bürokratischer AufwandLipedemPortalDie Ästheten - Medical Spa.
Zusätzliche Anforderungen (Qualitätssicherung): Durchführung durch Ärzte mit entsprechender Erfahrung und Kassenzulassung; Praxen ohne solche Zulassung können nicht abrechnenLipedemPortalWikipediaS-thetic.
Neue Regelung ab 2026 (Entscheidung vom Juli 2025, noch in Prüfung)
Ausweitung der Kassenleistung: Liposuktion soll ab dem 1. Januar 2026 in allen Lipödem-Stadien (I–III)eine Leistung der GKV werdenstuttgarter-nachrichten.deLeading Medicine Guidedr-nichlos.deFinanztipWikipedia.
Übliche Bedingungen bleiben: Konservative Therapie, stabiles Gewicht, Fachärztliche Diagnosen etc. sind weiterhin VoraussetzungLeading Medicine Guidedr-nichlos.deWikipedia.
Noch nicht vollständig umgesetzt: Der Beschluss muss vom Bundesministerium für Gesundheit geprüft und veröffentlicht werden; EBM-Abrechnungsziffern müssen bis spätestens 1. Januar 2026 festgelegt werdenstuttgarter-nachrichten.deLeading Medicine GuideFinanztip.
Private Krankenversicherung (PKV)
Größere Flexibilität: In vielen Tarifen wird die Liposuktion als medizinisch notwendig anerkannt — auch bei Lipödem Stadien I und II und ohne komplexes GenehmigungsverfahrenCLARK.
Zusammenfassung kurz:
| Zeitraum | Stadium | Kostenübernahme möglich? | Wichtige Zusatzbedingungen |
|---|---|---|---|
| Bis Ende 2024 | III | Ja | Konservative Therapie, BMI ≤ 35, Gewicht stabil, Diagnose durch Facharzt |
| Ab 1. Jan. 2026 | I–III | Geplant | Gleiche Bedingungen, Umsetzung nach EBM-Abrechnung noch offen |
| PKV | I–III | Häufig ja | Individueller Tarif abhängig |
Lipödem Düsseldorf - Spezialistin Doc. Taina Thoma
Lipödem OP - Fettabsaugung
- Kosten: ab 2500 Euro
- Dauer: ca. 15 - 90 Minuten
- Ort: Düsseldorf (Meerbusch)
- Gesellschaftsfähig: meist sofort, ggf. kleine Schwellungen möglich
